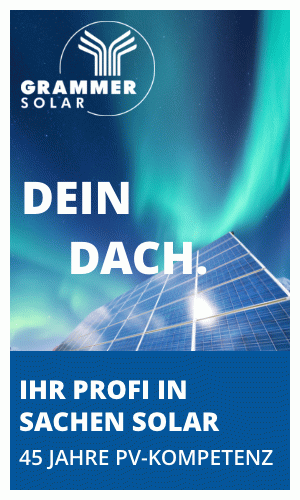Vergessene Schlacht: Das Leid der Oberpfalz 1796
Vergessene Schlacht: Das Leid der Oberpfalz 1796
Bei dieser Schlacht, über die schon viel geschrieben wurde, kamen rund 1.400 Soldaten ums Leben. Doch – wie erging es den Menschen in der Umgebung, die unter den kriegerischen Auseinandersetzungen zu leiden hatten (und anderswo heute auf der Welt noch leiden)? Beispielhaft für andere Märkte und Dörfer kann man zum Beispiel in den Chroniken von Schnaittenbach und Hirschau über die Auswirkungen auf die Bevölkerung viel Interessantes nachlesen.
Ein Jahrhundert voller Konflikte
Wie das Jahrhundert kriegerisch angegangen, so sollte es auch enden. Schnaittenbach und Hirschau, an einer wichtigen Durchgangsstraße gelegen, wurde 1796 in den Strudel der kriegerischen Ereignisse gezogen. Die meisten europäischen Länder, darunter Bayern, hatten sich gegen die französische Republik verbündet. In der Absicht, die österreichischen Truppen zu vertreiben beziehungsweise sie von mehreren Seiten anzugreifen und nach Böhmen vorzustoßen, drang die französische Nordarmee unter General Jourdan in die Oberpfalz ein.
Das Nahen der französischen Truppen kündigte sich bereits am 14. August an, als die Stadt Hirschau 24 vierspännige Wagen nach Sulzbach schicken musste, um von dort die österreichischen Magazine nach Vohenstrauß vor den anrückenden Franzosen in Sicherheit zu bringen.
Am 17. August fiel Amberg in Feindeshand, nachdem sich die österreichischen Truppen an die Naab zurückgezogen hatten. Noch am selben Tage hatte Hirschau 60 Viertel Hafer, je 5.000 Bund Heu und Stroh zur kaiserlichen Armee nach Amberg geliefert. An diesem Tage war es bereits zwischen Franzosen und Österreichern zwischen Sulzbach und Amberg zum Gefecht gekommen. Zwischen 14 und 15 Uhr erschien die französische Vorhut vor ihren Toren. Ihre erste Forderung lautete auf 60 Säcke Hafer, 500 Bund Heu und 500 Laib Brot und gab einen ersten Vorgeschmack dessen, was die Stadt erwartete. Bis gegen 18 Uhr wimmelte die Stadt und ihre Umgebung von Franzosen, angeblich 20.000 Mann. Noch in derselben Nacht forderten sie 25 Zentner Fleisch.
Die Belagerung der Stadt Hirschau
In den Tagen vom 18. bis 20. August waren an einzelne französische Soldaten zur Beschwichtigung unerschwinglicher Forderungen 210 Gulden bezahlt worden, und es schien für die gequälte Stadt eine Atempause einzutreten, als die Franzosen ihren Vormarsch gegen Wernberg und Nabburg antraten. Am 23. August erschien aus dem französischen Quartier in Nabburg ein Chasseur mit der schriftlichen Forderung der französischen Administration auf 10.000 Brote zu je drei Pfund, 700 Sack Hafer und 20 Eimer Branntwein. Bitten und Hinweise auf die Unmöglichkeit, solcher Forderung nachzukommen, blieben erfolglos – es ging wohl hauptsächlich um Gelderpressung.
Der Rückzug und die Folgen
Unterdessen setzte der französische Rückzug von Schwarzenfeld und Nabburg her teils über Hirschau, teils über Nabburg vor den nachdrängenden Österreichern ein. Wiederum war die nächste Umgebung der Stadt Hirschau voll von französischer Infanterie und Kavallerie, war feindliche Artillerie aufgefahren.
Zum Glück für die Stadt Hirschau zogen die Franzosen nach zwei Stunden ab, nur verwundete Offiziere blieben zurück, beim Hirschenwirt war einer von ihnen untergebracht. Lefevre zog am 24. August mit zwölf Bataillonen durch Schnaittenbach bis Hahnbach, wo er eine beobachtende Stellung einnahm. Diese Kolonne ließ es laut Walter Volland nicht an Gewalttätigkeit fehlen. Sie plünderte und brandschatzte.

Die Auswirkungen auf die Bevölkerung
Den Pfarrer Dorfner plünderten sie total. Im Pflegamt Hirschau betrug der Schaden 24.500 Gulden. Alle Pferde und Ochsen wurden zum Einspannen requiriert. Die meisten Bewohner hatten sich vor Schrecken bereits beim ersten Durchzug in die Wälder geflüchtet. Auch das Vieh trieben sie in das Dickicht des Waldes. Aus Forst waren die Einwohner ebenfalls in die umliegenden dichten Wälder geflohen. Im Mittlerwald hing an einer Tanne eine Glocke, um die Leute dort zu vereinigen. Noch lange nachher war diese “Glöckltanne” bekannt.
Das Vorgehen der französischen Truppen wird in einer Schrift aus dem Jahre 1796 geschildert. Es wurden die grausamsten und mutwilligsten Plünderungen und Räubereien während dieser Zeit begangen. Eine Aufstellung über die Schäden in Hirschau findet man auf Seite 163 der Hirschauer Chronik. Durch die rohe Behandlung der Bevölkerung durch die Franzosen war die Bevölkerung derart erbittert, dass viele Nachzügler umgebracht wurden.
Landgraf erzählt, dass in den letzten Jahrzehnten des vorigen (19.) Jahrhunderts bei der Ausbesserung des Bachdamms hinter Haus-Nr. 24 (jetzt Wernberger Straße 24) in Schnaittenbach Säbel und Gewehrteile zum Vorschein gekommen seien, die angeblich von ermordeten Franzosen stammen würden. Zwischen 11 und 16 Uhr kam es dann zur Schlacht bei Amberg zwischen den Österreichern und Franzosen, wobei hier die Franzosen geschlagen wurden.
Der Sieg des Erzherzogs Karl am 24. August zwang die Franzosen zum Rückzug. Österreichische Truppen rückten ein und legten nach Schnaittenbach große Abteilungen ihrer Lazarette. In der Oberpfalz waren mit dem Sieg bei Amberg zwar keine Franzosen mehr, aber nun ordnete Erzherzog Karl die Requisition von etwa 200.000 Laib Brot und 2.000 Scheffel Hafer an. Für die Stadt Amberg, die erst unter den Franzosen schwer gelitten hatte, war diese Forderung unerfüllbar, sodass auch umliegende Orte zu deren Erfüllung herangezogen werden mussten. Den Markt Schnaittenbach traf die Lieferung von 280 Laib Brot und 3 ½ Zentnern Hafer an das Wartenslebensche Armeekorps nach Sulzbach.
Die langfristigen Folgen
Als am 30. August 25 Husaren vom Veczey-Regiment mit 36 Pferden und der Kasse in der total ausgeplünderten Stadt Hirschau einquartiert werden sollten, zahlte man dem Quartiermacher 1 Gulden 12 Kreuzer, um die ungebetenen Gäste nach Gebenbach weiterzubringen. Mit Recht beklagten sich am 5. Oktober Schnaittenbacher Bürger in einer Eingabe, dass “wie teils durch die in unserem Markte und Revier scharenweis immer anwesend gewesenen kaiserlichen und französischen Truppen, teils durch die schon vorhin und gegenwärtig noch immer wöchentlich, ja schier täglich andauernde Durchmarsch und kostspielige Einquartierungen vieler kaiserlich-königlichen Soldaten nicht nur allein an Exercierung unserer Professionen, dann Bearbeitung des Feldbaus vielfältig gehindert … (sind)”.
Unwetter, Pest oder Seuchen
Zu den Kriegsereignissen, die unsere beiden Städte über Jahrhunderte immer wieder aufsuchten, kamen auch noch andere Ereignisse: Unwetter, Pest oder Seuchen. Besonders schwer traf die Bürger eine Viehseuche, die 1796 nach dem Abzug der Franzosen Schnaittenbach und Umgebung heimsuchte. Sie schädigte den ohnedies verminderten Viehbestand. Innerhalb kurzer Zeit sah man sich genötigt, um wenigstens die benötigte Milch zu erhalten, Ziegen einzustellen.
In Ermangelung von Zugvieh wurde auch der Feldbau beeinträchtigt. Zur Viehseuche gesellte sich eine Krankheit, die mehrere Todesfälle zur Folge hatte und ganze Familien erfasste. Um die durch französischen Truppen hervorgerufenen Schäden von mehr als 100.000 Gulden in der Landgrafschaft Leuchtenberg zu vergüten, nahm die Regierung 1797 ein Darlehen auf, zu dem auch die Kirche in Schnaittenbach 200 Gulden beitragen musste. Ein weiteres Darlehen musste sie 1798 zur Amberger Kriegskasse als Vorlehen von 24 Gulden leisten. In Hirschau und Umgebung kam es am 18. August 1798 auch noch zu einem schrecklichen Schauerwetter.
Wiederkehrende Belastungen
Schon in den Jahren 1809 (Schlacht bei Eggmühl – Napoleon vor Moskau) bis 1814 wurden unsere Städte wieder von den Auswirkungen der Kriegswirren betroffen. So kam es wieder zu Einquartierungen. Beispielhaft sei erwähnt, dass die Österreicher stahlen, raubten und erpressten. In ganz Hirschau war kein Hafer mehr aufzutreiben.
In einem Artikel hat Reinhold Strobl auch noch folgendes gefunden: Fürst Metternich berichtet in einer Notiz von Wutausbrüchen Napoleons. Bei den Friedensverhandlungen soll Napoleon gebrüllt haben: “Ein Mann wie ich scheißt auf das Leben von einer Million Menschen.” Ein Zitat, das auch von vielen anderen Feldherren (auch in unserer heutigen Zeit) stammen könnte.
 Jobbörse
Jobbörse
 Events
Events
 Mediathek
Mediathek

 Suche
Suche
 Login
Login