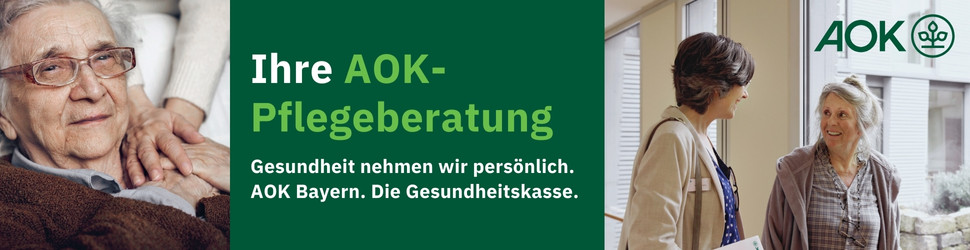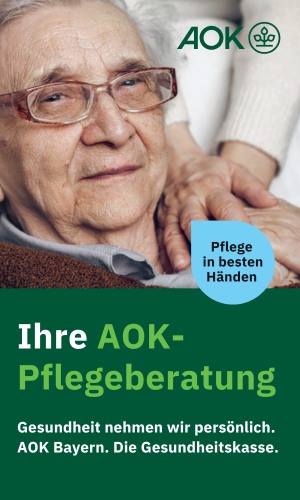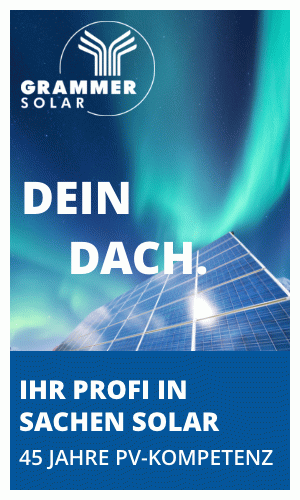Sehenswerte Ausstellung: Die Verleugneten in KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Sehenswerte Ausstellung: Die Verleugneten in KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Die Ausstellung ist noch bis 14. September in der ehemaligen Häftlingsküche zu sehen (täglich 9 bis 17 Uhr). Am 24. August, 15 Uhr, wird ein geführter Rundgang durch die Ausstellung angeboten.
Eröffnet wurde die Ausstellung im Oktober 2024 in Berlin, danach wandert sie nach Köln. An jedem Ausstellungsort wird sie um lokale Schicksale ergänzt. Hier, in der Oberpfalz, ist das unter anderem die Glasschleifer-Tochter Margarete Obermeier (Jahrgang 1900, 1976 in Weiden verstorben).
Monika Grötsch hat sich intensiv mit den Lebensgeschichten der “Verleugneten” auseinandergesetzt. Seit 2012 ist sie Rundgangsleiterin in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Selbst sie erschrak über die erbärmlichen Lebensbedingungen, denen die Arbeiterfamilien in den Glasschleifen der Region ausgesetzt waren: “Ich wusste nicht, wie furchtbar die waren.”
Das Schicksal von Margarete Obermeier
Margarete “Gretl” Obermeier wächst zusammen mit vier Geschwistern in Glasschleifen in Goldbach (bei Vohenstrauß) und Riglasreuth auf. Ihr Vater verdingt sich als Tagelöhner. Auch die Kinder und die Mutter müssen mitarbeiten. Mit Quarzsand, Quecksilber und Potée, einem Eisenoxid, wird unter Beigabe von Wasser Glas zu Spiegel poliert. Das “Schleiferg’schwerl” ist von weitem erkennbar: Ihre Hände und Gesichter sind durch das Potée rot gefärbt.
Die Familien leben beengt, wie es ein Gerichtsarzt des Königlich Bayerischen Landgerichts Vohenstrauß 1887 beschreibt: “Sie liegen häufig, männlich wie weiblich, auf dem offenen Hausboden, der selten mit einem Lattenverschlag versehen ist.” Die Armut ist der ständige Begleiter.
“Asoziale Elemente” in Konzentrationslager verlegt
Gretl Obermeier sucht ab Ende der 1920er Jahre ihr Glück in München: “Sie will da raus.” Dabei gerät sie ins Rotlichtmilieu. Unklar bleibt, so Monika Grötsch, ob sie selbst als Prostituierte gearbeitet hat. Offiziell steht sie unter “Sittenkontrolle”. Als sie mit Diebesgut als Hehlerware erwischt wird, verurteilt sie das Landgericht München zu vier Jahren Zuchthaus.
Auf drei Jahre im Frauengefängnis Aichach folgt 1943 der Transport in das KZ Ravensbrück, dann in das Außenlager Graslitz des KZ Flossenbürg. Die Verlegung von der JVA in Konzentrationslager ist politischer Wille: Das Reichsjustizministerium und Heinrich Himmler, Reichsführer SS, verlegen alle “asozialen Elemente” aus den Gefängnissen in Konzentrationslager. Ziel: Vernichtung durch Arbeit. Margarete Obermeier muss unter schwersten Bedingungen Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie leisten. Im Frühjahr 1945 werden die KZ aufgelöst. Sie muss mit auf den Todesmarsch und wird im Mai 1945 von den Amerikanern befreit.
Nach dem Zweiten Weltkrieg nicht als Opfer anerkannt
Entschädigung? Fehlanzeige. Menschen wie Margarete Obermeier wird die Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus verwehrt. Bis zum Tod bleibt das Stigma der “Asozialen”, des “Kriminellen” an den Inhaftierten kleben. Man schämt sich noch heute. “Selbst bei den Recherchen für die Ausstellung sollen Risse in den Familien spürbar gewesen sein”, sagt Monika Grötsch.
Nach Kriegsende kehrt Margarete Obermeier nach Weiden zurück. Sie leidet an den gesundheitlichen Folgen der KZ-Haft und kann nicht arbeiten. Die kinderlose Frau wohnt in einem heruntergekommenen Zimmerchen im damaligen “Glasscherbenviertel”, Hinter der Mauer, in Weiden. Auf eine Entschädigungszahlung hat sie als “Asoziale” keinen Anspruch. 1976 stirbt sie verarmt in Weiden. Es gibt kein Foto von ihr.
Ausstellung zeigt exemplarische Schicksale
Ein Schicksal von etwa einem Dutzend, die in der Ausstellung “Die Verleugneten” in Ton, Bild und Dokumenten vorgestellt werden. Keines ist gleich, jedes ist erschütternd. Da ist Sibilla Rombach, 17 Jahre alt, deren “Verbrechen” ist, dass sie von zu Hause wegläuft. “Eine junge Frau, die ausbricht”, erklärt Monika Grötsch. “Mal chillen? Das ging damals nicht.” Ihre Eltern holen sich vermeintlichen Beistand bei der Fürsorge – und fällen damit das Todesurteil über ihre Tochter. Sibilla wird 1943 zur “Vorbeugungshaft” ins KZ Ravensbrück eingewiesen, wo sie 1945 im Alter von 23 Jahren stirbt.
Es genügen ein “liederlicher Lebenswandel”, Landstreicherei oder Betteln. Diese Menschen sollen keinen Platz in der “deutschen Volksgemeinschaft” haben. Und so triff es auch Max Handl, einen Harmonikaspieler aus dem Regensburger Umland. Handl ist “kein einfacher Mann”, so Monika Grötsch: Er trinkt, versäuft das Geld, schlägt Kinder und Frau. Und wenn er zu viel getrunken hat, spottet er in den Wirtshäusern über die Obrigkeit.
Sein Ende? Er wird als “arbeitsscheu” ins KZ Dachau gebracht, wo er 1939 ums Leben kommt. Bei der Eröffnung in Flossenbürg im März kamen auch Angehörige der „Verleugneten“ zu Wort. Darunter war auch der Urenkel von Max Handl: Christian Eckl, Mitglied der Chefredaktion der Mediengruppe Bayern.
“Die Verleugneten”
“Die Verleugneten. Opfer des Nationalsozialismus 1933 – 1945 – heute” ist bis 14. September 2025 in Flossenbürg zu sehen.
 Jobbörse
Jobbörse
 Events
Events
 Mediathek
Mediathek

 Suche
Suche
 Login
Login