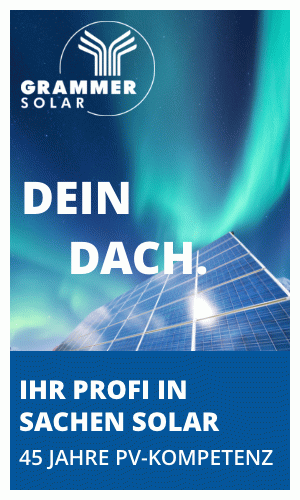Pressath strebt Wärmewende noch dieses Jahr an
Pressath strebt Wärmewende noch dieses Jahr an
Gebäudesanierung bringt Energiewende vorwärts
Gut die Hälfte des in der Bundesrepublik erzeugten und 77 Prozent des in Pressath verbrauchten Stroms stammen bereits aus Sonne, Wind und Wasserkraft. Bei der Heizwärme liegt der Anteil erneuerbarer Energiequellen jedoch bundesweit erst bei etwa einem Fünftel, und auch in Pressath gehen noch rund 70 Prozent der für Heizungen und Warmwasser produzierten Wärmeenergie auf die „fossilen“ Energieträger Heizöl, Erd- und Flüssiggas zurück.
Im Hinblick auf das im bayerischen Klimaschutzgesetz definierte Ziel eines bis 2040 „klimaneutralen“ Bayerns sei dieser Zustand unbefriedigend, stellten Tobias Eckardt und Markus Windisch von „Bayernwerk Netz“ sowie Adrian Hausner vom Rosenheimer Institut für nachhaltige Energieversorgung in der Pressather Stadtratssitzung klar. Als Fachleute für Wärmenetzplanung beraten die drei Referenten die Stadt bei den Vorarbeiten für eine kommunale Wärmeplanung. Die Eckpunkte hierfür haben alle bayerischen Kommunen bis 30. Juni 2028 zu erarbeiten, jedoch will Pressath dieses gesetzlich vorgegebene „Wärmewende“-Ziel sogar noch heuer erreichen, um eine auf 80 Prozent aufgestockte Förderung nach dem BundesWärmeplanungsgesetz zu erhalten. Kommunen, die diese zeitliche Vorgabe nicht einhalten, können höchstens mit einem 60-Prozent-Zuschuss rechnen oder gehen leer aus.
Potenziale für Verbrauchseinsparungen
Wo liegen nun die Potenziale für Verbrauchseinsparungen und verstärkten Einsatz regenerativer Ressourcen? Die Bestands- und Potenzialanalyse, so die Experten, habe zunächst ergeben, dass bei größtmöglichem Ausbau des Dachsolarthermie-Anlagennetzes gut 130.000 Megawattstunden (MWh) Wärmeenergie pro Jahr generiert werden könnten. In der Praxis werde das aber nicht zu erreichen sein, und der Anteil der aus Sonnenenergie gewonnenen Wärme werde in 20 Jahren wohl nur etwa ein Zehntel hiervon betragen. Gegenüber derzeit 554 MWh wäre dies aber auch bereits eine gewaltige Steigerung.
Bei der aus Biomasse gewonnenen Energie errechneten die Referenten ein Potenzial von rund 100.000 MWh, was einer Versiebenfachung gleichkäme. Als Hauptenergiequelle komme hier das Holz aus den großen Waldflächen im Stadtgebiet in Betracht. Für einen weiteren Ausbau der aus „Energiepflanzen“ gewonnenen Energieproduktion sehe man demgegenüber wenig Spielraum, zumal deren Anbau insbesondere mit der Nahrungsmittelproduktion konkurriere. Ein Potenzial für „hohe Standorterträge“ bestehe bei der Windenergie, „oberflächennahe Geothermie“ sowie „Umweltwärme“ aus der Luft könnten „als dezentrale Lösungen zielführend“ sein.
Bedeutung der Gebäudesanierung
Eine besonders große Bedeutung weisen die Energieberater jedoch der Gebäudesanierung zu: Sie könnte bis 2045 den Wärmeenergieverbrauch um rund ein Viertel vermindern. Statistisch würde dies erfordern, dass im Stadtgebiet pro Jahr 22 Wohngebäude energetisch saniert würden. Eine allmähliche Umstellung der Heizungsanlagen auf regenerative Quellen werde sich aus gesetzlichen Vorgaben ableiten, denn in Gebieten, die die Kommune als „Wärmenetzgebiet“ ausweise, müssten Neubauten ab dem Zeitpunkt dieser Ausweisung mit Heizungsanlagen ausgestattet werden, die ihren Energiebedarf zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Quellen deckten.
Das Gleiche gelte, wenn nicht mehr reparierbare Heizungsanlagen ausgetauscht werden müssten. In Gebieten, die nicht als Wärmenetzgebiete gälten, griffen diese Vorschriften ab 1. Juli 2028. Die Referenten erinnerten daran, dass die planerischen Vorarbeiten bis Jahresende mit der Ausarbeitung eines „Zielszenarios“ für die langfristige Entwicklung der Wärmeversorgung und mit der Entwicklung einer Umsetzungsstrategie vorerst abgeschlossen würden. Die weitere Entwicklung werde dann etwa alle fünf Jahre untersucht und dokumentiert. Die Details der Umsetzung einschließlich der Zeitplanung seien allein Sache der Stadt, die Wärmeberatung schaffe auch keine Pflicht zum Bau von Wärmenetzen. Bürgermeister Bernhard Stangl und der Stadtrat nahmen diese Darlegungen zur Kenntnis.
 Jobbörse
Jobbörse
 Events
Events
 Mediathek
Mediathek

 Suche
Suche
 Login
Login