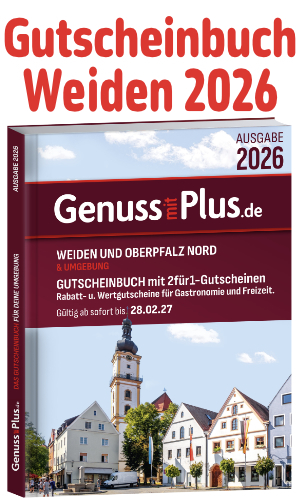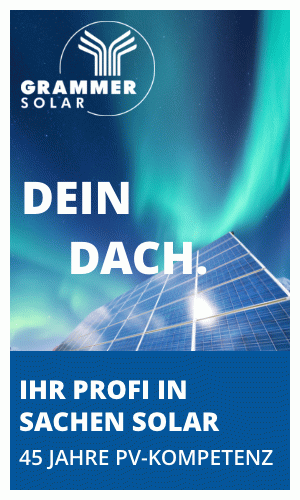Achtung Zeitumstellung: Warum wir am Wochenende an der Uhr drehen müssen
Achtung Zeitumstellung: Warum wir am Wochenende an der Uhr drehen müssen

Achtung: Zeitumstellung! Traditionell wird am letzten Oktoberwochenende die Zeit um eine Stunde zurückgedreht – oder alternativ die Uhr für eine Stunde angehalten.
Während die einen die zusätzliche Stunde im Herbst genießen, kämpfen andere mit Müdigkeit und Mini-Jetlag. Die Umstellung ist längst Routine, doch ihre Geschichte, die technische Umsetzung und die Diskussion um Sinn oder Unsinn sind interessanter, als viele denken. OberpfalzECHO informiert über die Details.
Was steckt dahinter?
Für uns alle ist das Pflicht: Zweimal im Jahr stellen Millionen Deutsche ihre Uhren um – im Frühjahr eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück. Diese Routine wirkt selbstverständlich, doch ihre Ursprünge reichen weit zurück.
Wenige von uns wissen: Zum ersten Mal führte Deutschland die Sommerzeit im Jahr 1916 ein, mitten im Ersten Weltkrieg. Ziel war es, das Tageslicht besser zu nutzen und so Energie zu sparen. Nach dem Krieg verschwand die Regelung wieder, tauchte dann mehrfach auf – aber seit 1980 ist sie fester Bestandteil unseres Alltags.
Viele von uns erinnern sich noch an das angsteinflößende Wort „Ölkrise“. Die extremen Erhöhungen der Rohölpreise 1973 und 1979/1980 der OPEC wurden damals als Ölkrisen bezeichnet. Tatsächlich spielten diese Bedrohung sowie die Energiepolitik und die europäische Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle. Einheitliche Zeiten innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sollten den grenzüberschreitenden Verkehr, den Handel und den Austausch erleichtern.
Seither gilt die einfache Faustregel: Im Frühjahr wird vorgestellt, im Herbst zurückgestellt. Obwohl die Einführung ursprünglich eine wirtschaftliche Maßnahme war, ist sie längst ein kulturelles Phänomen. Für viele ist der Wechsel eine Art „Ritual des Jahreslaufs“ – für andere einfach nur lästig.
Zeitumstellung: An alles denken!
Natürlich spielt sich die Zeitumstellung in unseren Haushalten eine zentrale Rolle. Deshalb gilt es spätestens am Sonntagmorgen die Uhren umzustellen:
- Wecker
- mechanische Armbanduhren
- mechanische Standuhren
- automatische Rollläden
- Uhren an Haushaltsgeräten (z. B. Herd, Mikrowelle)
Handys werden in der Regel automatisch der Zeitumstellung angepasst.
Wie läuft die Zeitumstellung in einem Uhrengeschäft?
Stefan Gruhle vom gleichnamigen Uhrengeschäft in der Weidener Schulgasse lächelt entspannt auf die Frage, wie viele Uhren er umzustellen hat: „Zuhause habe ich tatsächlich zu tun, bis alles auf der Höhe der Zeit ist. In meinem Geschäft sind es (… längeres nachdenken …) nur drei Uhren.“ Er deutet auf die große mechanische Uhr hinter der Kasse und führt zu zwei anderen Wanduhren. „Die Armbanduhren in den Vitrinen werden erst beim Verkauf durch unser Fachpersonal auf die aktuelle Zeit sekundengenau eingestellt.“
Nach seiner Auskunft nehmen es vor allem Senioren gerne an, insbesondere ihre Armbanduhren an die Zeitumstellung im Fachgeschäft anpassen zu lassen.
Wer legt eigentlich in Deutschland fest, was die Zeit geschlagen hat?
Die offizielle Zeit wird in Deutschland von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig verwaltet. Dort ticken extrem präzise Atomuhren, die die gesetzliche Zeit vorgeben. Über den Langwellensender DCF77 bei Frankfurt wird das Signal in Echtzeit im ganzen Land verbreitet – bis in Wohnzimmeruhren, Funkwecker und Computersysteme.
Besonders spannend wird es in der Nacht der Umstellung bei der Deutschen Bahn. Wenn die Uhr von drei auf zwei Uhr zurückspringt, bleiben die Züge, die zu dieser Zeit unterwegs sind, an einem Bahnhof stehen und warten eine Stunde, bis der Fahrplan wieder stimmt. Beim Vorspulen im Frühjahr – also beim Wechsel zur Sommerzeit – wird die fehlende Stunde einfach übersprungen. Moderne Technik sorgt dafür, dass Anzeigen, Leitstellen und Systeme synchron bleiben. Früher musste so etwas noch manuell koordiniert werden.
Zeitumstellung: Pro, Contra und Energiefrage
Befürworter der Sommerzeit schwärmen von langen, hellen Abenden: mehr Freizeit im Tageslicht, Zeit für Sport, Gartenarbeit, Grillen oder einen Spaziergang nach Feierabend. Besonders Gastronomie, Tourismus und Einzelhandel profitieren. Ein später Sonnenuntergang bringt eben mehr Leben in Straßen und Biergärten. Doch Kritiker halten dagegen: Der menschliche Körper tickt nicht so flexibel wie die Uhr. Studien zeigen, dass der abrupte Wechsel viele Menschen aus dem Rhythmus bringt. Schlafmediziner berichten von erhöhter Unfallgefahr, Reizbarkeit und Konzentrationsproblemen in den Tagen danach. Betroffen sind vor allem Kinder, ältere Menschen und Schichtarbeiter.
Auch das ursprüngliche Hauptargument – die Energieeinsparung – hat an Gewicht verloren. Zwar wird im Sommer abends weniger Licht verbraucht, doch der Heiz- und Kühlbedarf steigt. Eine Untersuchung der Europäischen Kommission ergab schon 2007, dass die Einsparungen im Promillebereich liegen. Heute ist klar: Die Energiefrage spielt keine tragende Rolle mehr. Hinzu kommt der organisatorische Aufwand in Wirtschaft und Verwaltung. Systeme, die rund um die Uhr laufen – von Flugplänen bis zu Servern – müssen doppelt geprüft werden. Fehler in der Zeiterfassung oder in Softwarelogiken kommen regelmäßig vor, auch wenn sie meist schnell korrigiert werden.
Biorhythmus, EU-Debatte und Eselsbrücken
Die innere Uhr des Menschen reagiert empfindlich auf Licht und Dunkelheit. Wird dieser Rhythmus um nur 60 Minuten verschoben, braucht der Körper oft mehrere Tage, um sich anzupassen. Der Effekt ähnelt einem Mini-Jetlag – nur dass wir ihn zweimal im Jahr erleben. Chronobiologen betonen, dass besonders die Umstellung auf Sommerzeit belastend ist, weil wir eine Stunde Schlaf „verlieren“. Viele Menschen fühlen sich in den folgenden Tagen müde, unkonzentriert oder gereizt. Tipps für die Umstellungswoche lauten deshalb: abends etwas früher ins Bett, morgens direkt nach dem Aufstehen ans Tageslicht, abends lieber kein Koffein mehr – so findet die innere Uhr schneller zurück ins Gleichgewicht.
Politisch ist das Thema seit Jahren umstritten. Die Europäische Union wollte 2019 eigentlich ein Ende der Zeitumstellung beschließen. Eine europaweite Umfrage ergab große Zustimmung für die Abschaffung. Doch die Umsetzung scheiterte: Die Mitgliedsstaaten konnten sich nicht darauf einigen, ob künftig dauerhaft Sommer- oder Winterzeit gelten soll. Bis dahin bleibt alles, wie es ist – und wir drehen weiter an der Uhr. Damit man beim Umstellen selbst nicht durcheinanderkommt, hilft eine einfache Eselsbrücke: „Im Sommer stellt man die Gartenmöbel vor das Haus – im Winter wieder zurück.“ Oder kurz: „Vor – zurück.“
Zeitumstellung ist Pflicht – ob wir wollen oder nicht!
Die Zeitumstellung ist für viele ein Relikt aus einer anderen Epoche – technisch überholt, aber gesellschaftlich erstaunlich beständig. Trotz Kritik, Gesundheitsdebatten und politischer Uneinigkeit bleibt sie vorerst bestehen. Positiv betrachtet schenkt sie uns immerhin zwei markante Momente im Jahr: einen besonders langen Frühlingstag im März und eine geschenkte Stunde Schlaf im Oktober. Ob das genug ist, um das ständige „Zeiger-Ritual“ zu rechtfertigen, bleibt Geschmackssache. Fest steht: Am letzten Oktoberwochenende heißt es wieder – Uhr zurückstellen und vielleicht kurz darüber nachdenken, wie sehr uns Zeit, Licht und Rhythmus doch miteinander verbinden.
 Jobbörse
Jobbörse
 Events
Events
 Mediathek
Mediathek

 Suche
Suche
 Login
Login