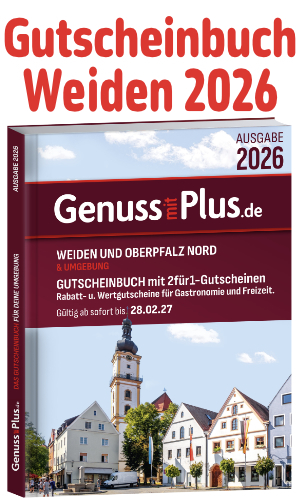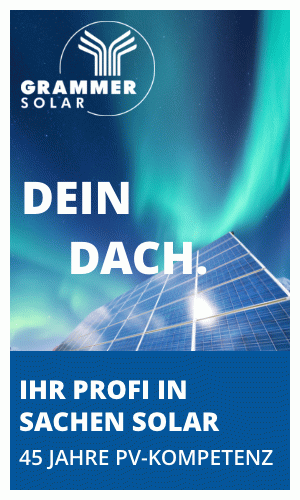Genussradeln durch die Parks der Stadt (4): Regensburg im Grünen Takt
Genussradeln durch die Parks der Stadt (4): Regensburg im Grünen Takt

Eine poetische Radtour durch Parks, Promenaden und stille Paradiese – ein botanisches Tagebuch auf zwei Rädern: Die Tour beginnt im Königswiesener Park – einem Rückzugsort für die Bewohner von Regensburgs Klein-Manhattan: Hier wilderte mein Pudelmischling Charly, der Hundegott habe ihn selig, am liebsten: offene Rasenflächen, sanfte Senken – ideal zum Rumtollen.
Nur schade oder vielmehr Schande, dass das einst prächtige, dann marode Gutshaus den Abrissbirnen der Stadt zum Opfer fiel. Und dort, wo jetzt im Königstor Rewe und Netto residieren, spielten wir als Kinder in den Ruinen des ehemaligen Herrensitzes – das im Zweiten Weltkrieg durch Bombenabwürfe stark beschädigte Ensemble wich bereits Ende der 1960er einem ersten Supermarkt-Komplex mit Pizzeria und Bowlingbahn.
Einstiger Gutshof Königswiesen
Fünf Hektar misst dieses grüne Refugium – beschirmt von Baumriesen, die schon standen, als Kriegstreiber Wilhelm II. noch Postkarten mit seinem herrischen Schnurrbart signierte. Viele dieser ehrwürdigen Gewächse wurzeln tief im 19. Jahrhundert, genauer: um 1895, als der Park als Teil des einstigen Gutshofes Königswiesen angelegt wurde – ein feudales Fleckchen Natur, das mehr weiß als es offenbart.
Heute erinnern nur noch stille Mahner an die großgrundherrliche Vergangenheit: die neuromanische Gruftkapelle, die die Familie Boutteville im 19. Jahrhundert erbauen ließ und die ebenso stur und standhaft den Zeitläuften trotzt wie die barocke Statue des heiligen Nepomuk, der einst die Stallungen zierte – als frommer Schutzpatron gegen Hochwasser, Klatsch und schlechte Geschäfte. Wer mit offenem Blick durch die Anlage streift, ahnt schnell: Hier rauscht nicht nur das Laub – hier spricht die Geschichte in Blättern, Sandstein und Schatten.

Die große Geste der kleinen Hügel
Wer den 3,5 Hektar großen Hegenauer-Park kurz nach der ehemaligen Sportanlage des TuS Süd (heute Übungsplatz des SSV Jahn) hinter der Autobahnbrücke in Königswiesen-Süd durchstreift, merkt kaum, dass hier nichts gewachsen ist, was nicht geplant wurde – und genau das ist sein Zauber: eine Kunstlandschaft, die aussieht wie ein Stück Mittelgebirge im Miniaturformat. 1989 im Rahmen des Grünflächenkonzepts mit Fingerspitzengefühl modelliert, wirkt sie heute wie das Werk eines Landschaftsbildhauers – mit geschwungenen Wegen, sanften Kuppen und überraschenden Ausblicken.
Ein serpentinenhafter Pfad folgt der sanften Topografie hinauf zu einem stillen Weiher, gespeist von einem 67 Meter tiefen Brunnen, der am höchsten Punkt des Parks verborgen liegt. Von dort aus fließt das Wasser als Lebensader durch die Anlage: zur Kneipp-Anlage auf der gegenüberliegenden Anhöhe und hinab in einen plätschernden Bachlauf, der sich über Findlinge schlängelt, ehe er elegant im Betonbecken ankommt – wo Natur und Konstruktion sich die Hand reichen. Eine kleine Holzbrücke, Schattenbänke, Vogelgezwitscher – wer hier innehält, merkt: Künstlichkeit ist kein Makel, wenn sie so unaufdringlich zur Erholung einlädt.

Erinnerungsort für jüdische NS-Verfolgte
Weiter geht’s, zurück über die Brücke vorbei am Von-Müller-Gymnasium – zwei Jahre Kollegstufe, da sich das Goethe-Gymnasium standhaft weigerte, einen Kunstleistungskurs anzubieten – zur Charlotte-Brandis-Anlage in Kumpfmühl – ein stiller Park mit großer Baumvielfalt, benannt nach der Regensburger Ehrenbürgerin und Kämpferin für soziale Gerechtigkeit. Seit Juli 2024 trägt der ehemalige Karl-Freitag-Park den neuen Namen. Er erinnert an das tragische Schicksal der jüdischen Regensburgerin, stellvertretend für viele Verfolgte der NS-Zeit.
Die rund 16.000 Quadratmeter große Grünanlage erstreckt sich als Teil eines durchgehenden Grünzugs vom Königswiesener Park bis zur Augsburger Straße. Die elegant geschwungene Topografie mit sanften Höhenzügen, einem sorgsam sanierten Teich und naturnaher Bepflanzung schafft ein harmonisches Ensemble, das den Besucher vom ersten Schritt an in eine stille Landschaft der Erinnerung und Erholung führt. Schon im Februar kündigt sich das Frühlingserwachen mit gelben Winterlingteppichen an, später setzen Wiesenstorchschnabel und Trauerweiden farbliche Akzente. Vogelarten, Fledermäuse und standorttypische Bäume wie Silberpappel, Moorbirke und Schwarzerle machen den Park zu einer artenreichen Kleinlandschaft.

Römer, Rüben, Ruhesessel
Eingerahmt von Bürgerheim, Simmernstraße und meiner Kommunions- und Firmungskirche St. Wolfgang wirkt der Karl-Bauer-Park heute wie ein stiller Gedanke mitten in der Stadt – doch unter seinem Rasen schlummert Weltgeschichte. Bereits 1496 urkundlich als Klostergarten von St. Emmeram erwähnt, ließ man hier Gemüse sprießen und Gänse schnattern, lange bevor die Stadt in Sichtweite war. Doch der Boden erzählt noch ältere Geschichten: Von römischen Kastellmauern, die hier einst standen, bevor Marc Aurel dem Donauufer sein Castra Regina einritzte.
Erst 2007 wurde der grüne Schatz für die breite Bürgerschaft geöffnet – zuvor diente er als privates Refugium für die Bewohner des benachbarten Bürgerheims. Heute steht im Zentrum das sorgsam restaurierte Salettl: ein pavillonartiges Kleinod mit morbidem Charme und blumengeschmückter Aura. Davor: zwei Sitzbänke aus dem 19. Jahrhundert, die morgens von der Sonne, nachmittags vom Frieden beschienen werden. Wer hier Platz nimmt, spürt: Geschichte ist nichts Abstraktes – sie sitzt mit einem auf der Bank.

Englischer Garten am Rande der Altstadt
Der Dörnbergpark am Rande der Altstadt trägt alles in sich, was einen klassischen englischen Landschaftspark auszeichnet: geschwungene Wege, weite Wiesen, malerische Blickachsen – und Baumriesen, die seit über 150 Jahren ihre Äste wie grüne Kaskaden zum Boden neigen. Über 1000 Bäume zählt man hier, von majestätischen Solitären bis zu jungem Unterholz. Freiherr Ernst Friedrich von Dörnberg, Chef der fürstlichen Gesamtverwaltung und Mitgestalter industrieller Aufstiege, erwarb 1832 das Gartenpalais an der Kumpfmühler Straße samt weitläufigem Park. Er ließ den Park verschönern, ein Rosarium, längst Lieblings-Bistro unserer Jugend mit herrlichem Garten, anlegen und den charmanten Pavillon im Schweizer Landhausstil errichten – bis heute ein architektonisches Kleinod im nördlichen Parkbereich.
Sein Sohn, ebenfalls Ernst Friedrich, vermochte das Vermögen zu mehren – und zugleich weitsichtig zu verwenden: „Ich bestimme mein gesamtes, wie immer namenhabendes Vermögen zur Unterstützung von Waisen …“, heißt es in seinem Testament. Die Gräfliche von Dörnberg’sche Waisenstiftung wirkt bis heute – unaufgeregt, wirkungsvoll, über Generationen hinweg. Und doch ist auch dieses Gartenidyll nicht gegen die Zeit gefeit. Ein unscheinbarer Pilz namens Phytophthora lässt die Wurzeln der alten Riesen faulen, entlaubt die Kronen, zwingt das Gartenamt zu Eingriffen. Zäune sichern Schösslinge, die eines Tages übernehmen sollen, was die Alten nicht mehr halten können.

Insidertipp: Park für Herzöge
Wer dem touristischen Treiben für eine Weile entfliehen will – ohne der Stadt den Rücken zu kehren –, findet im Herzogspark ein Refugium von bezaubernder Intimität. Eingebettet in den ehemaligen Stadtgraben aus dem 13. Jahrhundert, liegt diese grüne Enklave wie eine Oase zwischen den Zeiten. Frühaufsteher belohnt der Park mit einem Konzert aus Flötenkehlen und Flügelwippen, Botaniker mit seltenen Gewächsen, Flaneure mit lauschigen Winkeln – und Romantiker mit einem Blick über die alte Mauern und Donau hinweg zur Silhouette der Altstadt: ein Bild wie aus einem Canaletto-Stich, nur mit echtem Vogelgezwitscher.
An der Nordwestseite des Naturkundemuseums (Am Prebrunntor 4) schmiegt sich der Renaissancegarten mit seinem achteckigen Brunnen aus dem Jahr 1599 – ein Sandsteinmonolith, in den man Himmel, Pflanzenkunde und Wappenkunst gemeißelt hat. Ein kleiner Lehrpfad mit steinkundlichen Exponaten führt hinauf zum Prebrunntor von 1293, das heute als halber Turm in einer Bastion des 17. Jahrhunderts wohnt. Der Herzogspark, seit 1958 als Naturdenkmal geschützt, ist ein Lehrstück gelungener Koexistenz von Geschichte, Natur und kontemplativer Stadtkultur. Oder kurz gesagt: Wer ihn kennt, verrät ihn ungern weiter.
Zwischen Tartes au Soleil und Sushi: Hirokos Oase
Nach dem Spaziergang durch Herzogspark empfiehlt sich eine Rast im Stadtpark – genau dort, wo die Ostdeutsche Galerie zwischen Kunst, Brunnen und Bäumen thront. Und für alle, die Kunst gerne mit Croissant genießen: Das Pop-up-Café Tartine! Das charmante rote Feuerwehrauto französischer Herkunft parkt mittwochs vor dem Kunstforum Ostdeutsche Galerie – gefüllt mit hausgemachten Tartes, raffinierten Snacks und Kaffee, der schmeckt wie ein Sommer in der Provence. An ausgewählten Tagen gibt’s obendrein Kurzführungen durch die aktuelle Ausstellung – Kunst, Kultur und Kulinarik, so leichtfüßig inszeniert, dass die Parkbänke nach Paris duften.
Einen Katzensprung entfernt am westlichen Ende des Stadtparks an der Prüfeningerstraße liegt ein kulinarisches Kleinod fernöstlicher Eleganz: das japanische Restaurant Hiroko (https://hirokorestaurant.com/). Hier verschmelzen die meditative Klarheit der japanischen Küche mit der lebensfrohen Sinnlichkeit vietnamesischer Aromen – getragen von einer Philosophie der Dankbarkeit und des Respekts für alles Lebendige. Zwischen Neon-Schriftzeichen und Purismus wird jede Mahlzeit zur stillen Verneigung vor Natur, Handwerk und Gastlichkeit.
Ein Park mit Königsvilla und Jugendbühne
Ein weiterer Sehnsuchtsort unserer Jugend – lange Abende im Villa-Park, Open-Air, eine Flasche Bordeaux und der Duft nach Aufbruch. Doch lange vor den Regensburger Rocksternchen der 1980er war hier schon einmal andere Prominenz zur Kur: König Maximilian II. von Bayern, der 1852 in Regensburg verweilte, um sich in den angeblich heilsamen Donaubädern zu stärken. Dabei stellte Majestät fest, dass es in der Domstadt zwar einen Dom, aber kein angemessenes Logis für gekrönte Häupter gab – und beauftragte den Architekten Ludwig Foltz mit dem Bau eines standesgemäßen Sommersitzes, der später zur „Königlichen Villa“ wurde.
Der Park, der sich vom Waisenhausgarten über den alten Stadtgraben bis zur Villa selbst erstreckt, ist seither ein Ort mit mehreren Gesichtern: historischer Repräsentationsraum, grüne Verbinderin im Altstadtring – und stille Zeitzeugin städtischer Entwicklung. Während der östliche Teil einst als Nutzgarten für das benachbarte Waisenhaus diente, markiert der zentrale Stadtgraben bis heute die optische Zäsur. Der westliche Abschnitt, einst königlicher Vorgarten, steht längst der Allgemeinheit offen. Eigentümer ist der Freistaat, gepflegt wird die Anlage vom städtischen Gartenamt – und wer hier heute zwischen Linden, Skatern und Geigenspielern spaziert, spürt noch das Echo vergangener Sommernächte zwischen Monarchie und Jugendkultur. Anschließend ein Muss für Cineasten: das Ostentor-Kino, erstes Programmkino Regensburgs mit dem Chaplin-Restaurant und der Kino-Kneipe, in der so manche Filmnacht erst im Morgengrauen endete.

Donaupark & Allee: Das große Band entlang des Stroms
Hinab zur Donau und hinein in den Donaupark – der großzügigste der Regensburger Parks im äußeren Stadtwesten – mittendrin, umgeben von viel Grün und insgesamt sechs Kilometer langen Wegen, liegt der zwölf Hektar große Baggersee. Jogger, Bouler, Träumer, Familien und die Wasserwacht – hier begegnen sich Städter und Stadtteile.
Sie schmiegt sich wie ein grünes Band um die Altstadt – die Allee, einst als fürstlicher Prachtweg angelegt, heute Regensburgs eleganteste Flaniermeile unter Blätterdach. Zwischen 1779 und 1781 ließ Fürst Carl Anselm von Thurn und Taxis die Allee als grünen Kontrapunkt zur Donau schaffen – fast drei Kilometer zieht sie sich seither vom Westen bis zum Osten der Stadt und verbindet Parks, Plätze und Perspektiven zu einem lebendigen Denkmal höfischer Stadtplanung.
Inselpark Oberer Wöhrd & Jahninsel
Über die Protzenweiherbrücke erreichen wir den Inselpark Oberer Wöhrd, wo sich Donauwiesen mit naturnahen Uferzonen verbinden. Kinder plätschern mit den Füßen im Wasser, Studenten liegen lesend im Gras – ein stilles Juwel im westlichen Donauarm – umspült vom Fluss, abgeschirmt vom Lärm, durchzogen von Alleen und Aussichten. Zwischen schützenswerter Auenlandschaft, herbstgoldener Laubpracht und gelegentlicher Entenphilosophie entfaltet sich ein Ort, der den Atem der Stadt verlangsamt – ohne ihn zu verlieren.
Vom Oberen Wöhrd führt ein schmaler Pfad entlang des nördlichen Donauarms zur Jahn-Insel – im Sommer herrscht hier Hochbetrieb, im Herbst und Winter findet der einsame Wanderer eine fast entrückte Flusslandschaft – begleitet vom Rascheln der Blätter, dem Plätschern im Schilf und dem gelegentlichen Flügelschlag. Zwei hölzerne Stege überspannen einen längst versiegten Wasserlauf, der die Lauservilla wie ein vergessener Burggraben umgibt. Erst wenn sich vor einem die Steinerne Brücke erhebt, kehrt die Stadt zurück ins Bewusstsein – als Kontrast, nicht als Störung.
Winzerer Höhen: Die grüne Krone der Stadt
Der Max-Schultze-Steig ist ein verborgenes Gedicht aus Stein, Licht und Stille – das westlichste Naturschutzgebiet der Stadt, und doch fern jeder städtischen Geste. Südlich der Sinzinger Eisenbahnbrücke beginnt der Weg, zunächst unscheinbar über Felder und Wiesen, ehe er sich verwandelt: in einen grünen Tunnel, durchwoben von wildem Geäst, moosigen Stämmen und rankenden Schatten – mit Ausblicken ins weite Donautal, die zugleich still und überwältigend sind. Ein Ort, an dem die Natur nicht inszeniert, sondern erzählt – leise, wild und unvergesslich.
Nun ein kurzer Anstieg – und die Belohnung: Die Winzerer Höhen, mit ihrem berühmten Ausblick über Altstadt, Donau, Domspitzen. Der Parkcharakter liegt hier in der Landschaft selbst: Hanglage, Weite, Fernsicht. Wer will, legt sich auf eine Bank am Geländer und schaut der Stadt beim Atmen zu oder strampelt weiter zum Gasthaus „Huf“ am Ortseingang der Tremmelhauserhöhe – ein stiller Platz mit Blick auf Felder, Windräder und das Leben zwischen Stadt und Land.
Botanischer Garten & Aberdeenpark: Das Finale der Vielfalt
Der Rückweg führt durch den Botanischen Garten der Universität – ein Lehrgarten mit 4000 Arten, duftenden Stauden und einem mediterranen Quartier, das bei Sonne nach Lavendel riecht. Zum Abschluss ein Bogen durch den Aberdeenpark – ein Symbol internationaler Freundschaft mit Bänken, Wiesen und dem stillen Raunen globaler Nachbarschaft. Und dann rollt das Rad zurück durch das Aubachpark-Gelände in Burgweinting, wo Bach, Wiese und moderne Gartenarchitektur in sanftem Gleichklang enden.
Oben am Aberdeenpark öffnet sich der Blick nach allen Himmelsrichtungen: im Süden zur Altstadt, im Westen bis Lappersdorf, im Norden über Wutzlhofen hinweg zur Konradsiedlung und im Osten bis zum Sendemast des Keilbergs – ein 360-Grad-Panorama für Geist und Gemüt. Im Tast- und Duftgarten verströmen Lavendel, Minze und Zitronenmelisse ihre betörenden Noten, während rund um den von Angela Stösser geschaffenen Brunnen die Sinne tanzen dürfen. Und wer dem Weg bis ganz nach oben folgt, erreicht die kleine, von Helga und Peter Ittlinger gestiftete Kapelle.
🌿 Infokasten: Radtour durch das grüne Regensburg
- Länge: ca. 28–35 km
- Dauer: 4–5 Stunden inkl. Aufenthalten
- Start/Ziel: Königswiesen – Rundtour
- Highlights:
- Königswiesener Park & Charlotte-Brandis-Park
- Karl-Bauer-Anlage & Hegenauer Park
- Dörnbergpark, Villapark & Herzogspark
- Donaupark & Regensburger Allee
- Inselpark Oberer Wöhrd & Max-Schultze-Steig
- Winzerer Höhen mit Stadtpanorama
- Botanischer Garten & Aberdeenpark
- Aubachpark zum Ausrollen
- Tipp: Unterwegs auf eine Bank setzen, zuhören, wie Regensburg grün denkt
- Anspruch: Leicht – ideal für Genussradler, Familien und Freunde der langsamen Bewegung
Stil: Urban-natürlich, kulturhistorisch, atmosphärisch
 Jobbörse
Jobbörse
 Events
Events
 Mediathek
Mediathek

 Suche
Suche
 Login
Login